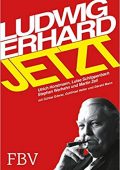Mit der Überhöhung des Prinzips, nur einer der Spitzenkandidaten könne Präsident der EU-Kommission werden, ist viel Verwirrung gestiftet worden. Denn die Mitgliedstaaten sind und bleiben die Garanten der europäischen Demokratie. Auch transnationale Wählerlisten wären ein Irrweg. Von Prof. Dr. Heinrich August Winkler Sorry, transnationale Listen sind der einzige Weg, um Repräsentanten des gesamteuropäischen Gemeinwohls zu erhalten,. Daher plädiere ich fuer Internet based transnationale representations, Ihr Stephan Werhahn
Von Kungeleien, von Geschachere und Geheimabsprachen in Hinterzimmern war die Rede: An starken Worten ließen es manche deutsche Kommentatoren nicht fehlen, als sich seit Mitte Juni 2019 abzeichnete, dass die Staats- und Regierungschefs der EU keinen der von den europäischen Parteifamilien nominierten Spitzenkandidaten dem Europäischen Parlament zur Wahl als Präsident der Kommission vorschlagen würden. Einige Autoren wollten die Europawahl vom Mai 2019 gar als Plebiszit für das Prinzip der Spitzenkandidatur verstanden wissen: Wenn der Europäische Rat sich nicht auf einen der Spitzenkandidaten, vorzugsweise den der stärksten Gruppierung, einigen könne, sei das Verrat am Wählerwillen und die Preisgabe der großen demokratischen Errungenschaft von 2014 – jenes Jahres, in dem das Straßburger Parlament den erfolgreichsten unter den Spitzenkandidaten auf Vorschlag des Europäischen Rats zum Kommissionspräsidenten gewählt und damit die Kommissionsspitze de facto parlamentarisiert hatte.
2014 war freilich manches anders als 2019. Die beiden Spitzenkandidaten, auf die es ankam, der luxemburgische Christdemokrat Jean-Claude Juncker und der deutsche Sozialdemokrat Martin Schulz, hatten sich von vornherein darauf verständigt, dass der erfolgreichere an die Spitze der Kommission treten, der andere ein anderes europäisches Spitzenamt übernehmen sollte. Dass Christ- und Sozialdemokraten zusammen über die Mehrheit der Sitze im Europäischen Parlament verfügten, war ein starkes Argument zugunsten dieses Arrangements. Der Europäische Rat fügte sich widerstrebend, ohne daraus einen Präzedenzfall machen zu wollen. Juncker wurde zum Kommissionspräsidenten, Schulz ein weiteres Mal zum Präsidenten des Europäischen Parlaments gewählt.
Weder 2014 noch 2019 haben die Spitzenkandidaten, von ihren jeweiligen Heimatländern abgesehen, in den Wahlkämpfen eine markante Rolle gespielt. Entsprechend gering war ihr Einfluss auf die Wahlentscheidung. In Deutschland büßten die Unionsparteien, obwohl sie mit dem CSU-Politiker Manfred Weber diesmal den Spitzenkandidaten der Europäischen Volkspartei stellten, gegenüber der vorangegangenen Wahl sogar erheblich an Stimmen ein. Dass die Wahlbeteiligung in Deutschland wie in der EU insgesamt anstieg, hatte andere Gründe: Mobilisierend wirkten der Brexit und die Sorge vor dramatischen Stimmengewinnen rechter Parteien.
Anders als 2014 verfügen Christ- und Sozialdemokraten im neuen Europäischen Parlament zusammen über keine Mehrheit mehr. Im Gegensatz zur vorangegangenen Wahl gab es 2019 auch keine Absprachen zwischen den beiden wichtigsten Spitzenkandidaten. Die Ansprüche, die Manfred Weber und sein sozialdemokratischer Konkurrent Frans Timmermans auf das Amt des Kommissionspräsidenten erhoben, blockierten sich vielmehr gegenseitig. Eine parlamentarische Mehrheit war für keinen der beiden in Sicht. Es hätte also gar nicht des massiven Widerstands des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron gegen Weber als Person und die Spitzenkandidatur als Prinzip bedurft, um eine Wiederholung der Konstellation von 2014 zu verhindern. In deutschen Medien war denn auch prompt von einem Versagen des Europäischen Parlaments die Rede.
Dasselbe hört man aus der Chefetage der Europäischen Volkspartei in Brüssel, der Protagonistin des Projekts Spitzenkandidatur. Hier, in der ehedem hegemonialen Formation der Europäischen Union, wird vor allem an jener Lesart gestrickt, der zufolge das Europäische Parlament das öffentlich agierende Sprachrohr der europäischen Demokratie sei, wohingegen sich im Europäischen Rat die partikularen, nationalstaatlichen Obrigkeiten artikulierten; und das grundsätzlich hinter verschlossenen Türen. Dass es auch parlamentarische „Hinterzimmer“ gibt, in denen zum Beispiel Spitzenkandidaturen und Vereinbarungen zwischen Spitzenkandidaten ausgehandelt werden, gerät bei dieser Betrachtungsweise nicht ins Blickfeld.
Kritische Einwände drängen sich aber auch im Hinblick auf den demokratischen Anspruch des Europäischen Parlaments auf. Es wird seit 1979 in allgemeiner, unmittelbarer, freier und geheimer, aber nicht in gleicher Wahl gewählt. Vielmehr verfügen die Mitgliedstaaten über vertraglich gesicherte Mandatskontingente, die die kleineren Staaten bevorzugen und die größeren benachteiligen. Das ist durchaus sinnvoll, ja unvermeidlich, um die Arbeitsfähigkeit des Europäischen Parlaments zu sichern und Staaten wie Malta, Luxemburg oder Estland zu einer parlamentarischen Vertretung zu verhelfen. Doch der Verzicht auf das Prinzip „one person, one vote“ geht auf Kosten der demokratischen Legitimation des Europäischen Parlaments. Wenn dieses alle Rechte eines demokratischen, aus gleicher Wahl hervorgegangenen Parlaments für sich beansprucht und die Vollparlamentarisierung der EU anstrebt, stärkt das nicht die demokratische Legitimität des Staatenverbundes. Das Gegenteil ist der Fall.
Die Gleichsetzung von Europäischem Parlament und europäischer Demokratie, wie sie zumal deutsche Abgeordnete des Straßburger Parlaments gern vornehmen, hat längst Züge eines erfolgreichen „framing“ angenommen. Es wird von Teilen der deutschen Presse, aber auch von manchen deutschen Politikern und Professoren erstaunlich unkritisch rezipiert und dadurch in seiner Wirkung verstärkt. Vergessen scheint, was das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil zum Vertrag von Lissabon zu diesem Anspruch festgestellt hat. In seiner zusammenfassenden Pressemitteilung vom 30. Juni 2009 heißt es: „Das Europäische Parlament ist weder in seiner Zusammensetzung noch im europäischen Kompetenzgefüge dafür hinreichend gerüstet, repräsentative und zurechenbare Mehrheitsentscheidungen als einheitliche politische Leitentscheidungen zu treffen. Es ist gemessen an staatlichen Demokratieanforderungen nicht gleichheitsgerecht gewählt und innerhalb des supranationalen Interessenausgleichs zwischen den Staaten nicht zu maßgeblichen politischen Leitentscheidungen berufen.“
Das Verdikt des Bundesverfassungsgerichts, die primäre Integrationsverantwortung liege in der Hand der für die Völker handelnden nationalen Verfassungsorgane, ist kein Ausdruck von deutschem Nationalismus, sondern eine demokratietheoretische Selbstverständlichkeit. Dass ein Teil der deutschen politischen Klasse und der deutschen Öffentlichkeit mit diesem Sachverhalt hadert, ist bemerkenswert. Deutschland hat in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts seinen Nationalstaat zugrunde gerichtet und tut gut daran, sich jeder Verabsolutierung von Nation und Nationalstaat zu widersetzen. Aus der deutschen Geschichte den Schluss zu ziehen, der Nationalstaat als solcher sei gescheitert und müsse zugunsten eines europäischen Bundesstaates oder einer Europäischen Republik aufgegeben werden, wäre jedoch eine allzu deutsch zentrierte Form des Lernens aus der Geschichte. In kaum einem anderen europäischen Land findet ein solches „postnationales“ Denken breiteren Zuspruch. Vielmehr erregt es Misstrauen, wenn der Ruf nach einer Überwindung von Nation und Nationalstaat gerade aus Deutschland zu hören ist. Auch das ist eine Folge der deutschen Geschichte des letzten Jahrhunderts.
Um das Demokratiedefizit der Europäischen Union zu mindern, bedarf es des Zusammenwirkens zwischen dem Europäischen Parlament und den nationalen Parlamenten. Es sind die in gleicher Wahl gewählten Volksvertretungen der Mitgliedstaaten, die der europäischen Einigung jenes Maß an demokratischer Legitimation zuführen können, auf das der Staatenverbund der EU existentiell angewiesen ist. Die Einführung einheitlicher transnationaler Kandidatenlisten bei den Wahlen zum Europäischen Parlament, wie sie seit einiger Zeit Präsident Macron vorschlägt, ist hingegen kein Mittel zur Demokratisierung der EU. Zwischen den Abgeordneten, die auf diese Weise gewählt werden, und ihren Wählern bestünde eine noch tiefere Kluft als zwischen den konventionell gewählten EU-Parlamentariern und ihrer nationalen Wählerbasis. Ein Zugewinn an europäischer Legitimation für das Straßburger Parlament lässt sich über transnationale Listen nicht bewirken. Die deutsche Politik ist gut beraten, wenn sie Macron auf diesem zentralistischen Irrweg nicht folgt.
Im Vertrag über die Europäische Union aus dem Jahr 2009 kommen „Spitzenkandidaten“ nicht vor. Dem Europäischen Rat obliegt es, dem Europäischen Parlament einen Kandidaten für das Amt des Kommissionspräsidenten zur Wahl vorzuschlagen, wobei das Ergebnis der Europawahl zu berücksichtigen ist. Berücksichtigen müssen die Staats- und Regierungschefs gleichzeitig aber auch die Besetzung weiterer europäischer Spitzenpositionen, nämlich die der Präsidenten des Europäischen Rats, des Europäischen Parlaments und der Europäischen Zentralbank sowie des Hohen Vertreters für die Außen- und Sicherheitspolitik. Dabei gilt es, den unterschiedlichen Interessen von Ost und West, Nord und Süd, von großen und weniger großen Staaten sowie den rivalisierenden Parteifamilien Rechnung zu tragen; außerdem muss die Verteilung der Funktionen auf Männer und Frauen bedacht werden.
Die Europäische Union ist ein buntscheckiges Gebilde. Die nationale, kulturelle und sprachliche Vielfalt Europas ist keine Last der Geschichte, die es abzuschütteln gilt; sie macht vielmehr den Reichtum des alten Kontinents aus. Der Nationalismus hat das in den Vordergrund gerückt, was die Nationen trennt; die Europäische Union baut auf dem auf, was sie verbindet. Es läge im ureigensten Interesse ihrer Mitglieder, wenn die EU nicht nur im Hinblick auf die Handelspolitik und den Binnenmarkt, sondern auch in den großen Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik mit einer Stimme sprechen könnte.
Eines aber gibt es nicht und wird es nach menschlichem Ermessen auch künftig nicht geben: ein einheitliches europäisches Staatsvolk, das sich als Souverän eine parlamentarisch kontrollierte Zentralgewalt schafft. Solange die Staatsvölker nichts anderes beschließen, wird es dabei bleiben, dass die Mitgliedstaaten des Staatenverbundes die Garanten der Demokratie sind.
Die EU steckt in einer multiplen Krise. Die Brexit-Krise wird sich in den nächsten Monaten weiter zuspitzen, die italienische Handelskrise, die bisher größte Herausforderung der Eurozone, ebenso. Dazu kommt die Krise des inneren Zusammenhalts der Staatengemeinschaft, ausgelöst durch die Gefährdung des Rechtsstaates in Staaten wie Ungarn, Polen, Rumänien und, was oft übersehen wird, Malta. Ihren Anspruch, eine Wertegemeinschaft zu sein, kann die EU nur aufrechterhalten, wenn sie ihre normativen Grundlagen auch dort zu verteidigen weiß, wo sie von den Regierungen in Frage gestellt werden. Um dieses Ziel zu erreichen, bedarf es eines engen Zusammenwirkens der im weitesten Sinn liberalen Mitgliedstaaten der Union. Eine solche intensive Kooperation ist auch aus einem anderen Grund und über den Rahmen der EU hinaus notwendig: Was wir so gerne europäische Werte nennen, sind in Wirklichkeit westliche Werte, wesentlich mitgeprägt durch die Vereinigten Staaten von Amerika. Und ebendort regiert seit Anfang 2017 ein Präsident, der mit diesen Werten nicht eben pfleglich umgeht.
Was die Europäische Union des Jahres 2019 nicht braucht, sind Streitigkeiten zwischen dem Europäischen Parlament und dem Europäischen Rat, geboren aus den persönlichen Ambitionen von Abgeordneten und dem korporativen Ehrgeiz von Fraktionen und begründet mit einem demokratischen Anspruch, der einer kritischen Überprüfung nicht standhält. Die Staats- und Regierungschefs haben ein demokratisches Mandat. Den Abgeordneten des Europäischen Parlaments könnte man ein solches Mandat uneingeschränkt nur dann zubilligen, wenn es statthaft wäre, eine Wahl demokratisch zu nennen, die nicht auf dem Prinzip der gleichen Wahl beruht. Das aber wäre ein Widerspruch in sich selbst.
Mit der ideologischen Überhöhung des Prinzips Spitzenkandidatur haben die Befürworter dieser Neuerung des Jahres 2014 vor allem in Deutschland, dem Ursprungsland des Begriffs und wohl auch des Projekts, viel Verwirrung gestiftet. Es ist höchste Zeit, dem entgegenzuwirken. Von der Missachtung des demokratischen Gleichheitsprinzips durch vermeintliche Freunde Europas profitieren im Zweifelsfall nur die Nationalisten, die der politischen Einigung Europas den Kampf angesagt haben. Die polemische Art und Weise, wie maßgebliche Abgeordnete des Straßburger Parlaments in den letzten Wochen sich über das mühsame Aushandeln von Kompromissen im Europäischen Rat geäußert haben, entbehrt nicht der populistischen Untertöne. Kompromissbereitschaft aber gehört zu den Grundlagen jeder Demokratie und erst recht eines Zusammenschlusses demokratischer Staaten wie der Europäischen Union.
Der Präsident der Kommission bedarf einer (qualifizierten) Mehrheit im Europäischen Rat und einer (einfachen) Mehrheit im Europäischen Parlament, also einer doppelten Mehrheit. Das Europäische Parlament hat die vorrangige Aufgabe, die Europäische Kommission zu kontrollieren. Es ist nicht seine Bestimmung, zusammen mit dem Kommissionspräsidenten einen Machtblock gegen den Europäischen Rat zu bilden. Die Erfahrungen der Jahre 2014 bis 2019 wirken in dieser Hinsicht abschreckend. Je früher die Straßburger Abgeordneten sich auf ihre wichtigste Aufgabe besinnen, desto besser ist es für die Europäische Union – und für die Sache der Demokratie.