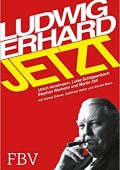Die Diskussion über die Reform der Währungsunion ist völlig aus dem Ruder gelaufen. von Werner Mussler, Brüssel , FAZ
Gelingt es der Bundeskanzlerin, den Bruch der CDU/CSU und der Regierungskoalition noch einmal abzuwenden? Und bekommt sie auf dem EU-Gipfel in zehn Tagen doch noch die von ihr so beschworene europäische Lösung hin? Wer diese dramatischen Fragen derzeit stellt, denkt an die Migrations- und Asylpolitik. Es ist völlig offen, wie lange Angela Merkel auf diesem Feld noch die Kontrolle behält, auf nationaler wie auf europäischer Ebene.
Doch stellen sich diese Fragen genauso auf einem zweiten Feld, wenn auch weniger offensichtlich. Auch die Reform der Währungsunion, die ebenfalls in zehn Tagen auf der Tagesordnung eines Gipfels (der Eurostaaten) steht, spaltet die CDU/CSU. Je mehr der Eurokompromiss, den Merkel und Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron mit ihren Regierungen an diesem Dienstag beim Treffen in Meseberg finden wollen, auf gut gefüllte Töpfe für die Währungsunion hinauslaufen und je weniger das dafür nötige Geld vom Bundestag kontrolliert werden soll, desto wahrscheinlicher wird es, dass größere Teile der Union einen solchen Kompromiss ablehnen.
Und wie auch immer die „Reform“ aussehen wird, auf die sich Berlin und Paris einigen werden, eine „europäische Lösung“ wird sie nicht sein. Der Eindruck, dass nur die beiden größten Eurostaaten einen Kompromiss finden müssen und dann der Rest der Eurozone folgt, ist grundfalsch. Viele Staaten lehnen neue Eurotöpfe ab. Deshalb wird es darüber auf dem Eurogipfel auch keine Einigung geben. Wahrscheinlich wird sich der Streit über den Eurohaushalt in den Gesprächen über den mittelfristigen EU-Haushaltsrahmen 2021 bis 2027 fortsetzen. Über diesen muss einstimmig entschieden werden.
Seit Macrons Sorbonne-Rede im September 2017 ist die Diskussion über Reformen für die Währungsunion nur noch ein Streit um mehr Geld. Kaum gesprochen wird darüber, welchen Sinn neue Euro-Umverteilungstöpfe haben sollen. Es geht allein darum, dass Deutschland dem Franzosen entgegenkommen und „endlich“ Macrons Visionen für den Euroraum folgen müsse. Es liegt in Merkels Verantwortung, dass sich die Diskussion ausschließlich in diese Richtung bewegt hat. Eigene Ideen zur Weiterentwicklung der Währungsunion hat sie bis vor zwei Wochen in ihrem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung nicht präsentiert.
Kaum noch überschaubar ist der Wust an Ideen für neue Fonds, Kreditlinien, Kapazitäten, Mechanismen und andere Finanztöpfe für allerlei Zwecke der Währungsunion, die in den vergangenen Monaten in Spiel gebracht wurden. Die in die Defensive geratene Kanzlerin hat selbst solche Töpfe vorgeschlagen, ohne begründen zu können, warum sie nötig sind. Ihr scheint es lediglich noch um Schadensbegrenzung zu gehen, also darum, die Fonds wenigstens nicht allzu groß werden zu lassen. Das mag ihr sogar gelingen, denn die Kernfrage, woher das Geld kommen soll, kann keiner von denen beantworten, die so laut danach rufen.
Die Diskussion ist völlig aus dem Ruder gelaufen. Es wird kaum noch gefragt, was die Mitgliedstaaten selbst zum Funktionieren der Währungsunion und zur Krisenprävention beitragen können. Und kein deutscher oder französischer Politiker, sondern der niederländische Finanzminister Wopke Hoekstra stellt die naheliegende Frage, welches Problem mit zusätzlichen Eurotöpfen eigentlich gelöst werden soll. Geht es um Konjunkturpolitik? Um Umverteilung? Um die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit? Oder einfach nur um den Nachweis einer irgendwie definierten europäischen Gesinnung? Und hat einer der Akteure in Paris und Berlin den Nachweis zu führen versucht, dass diese Ziele mit den Fonds zu erreichen sind?
Der „Schlechtwetterfonds“, den Merkel anregt, soll offenbar all den genannten Zielen irgendwie gerecht werden. Aus ihm soll einzelnen Eurostaaten bei schlechter Wirtschaftslage, die durch äußere Einflüsse und nicht durch die Politik verursacht wurde, eine Kreditlinie gewährt werden. Als Beispiel für einen möglichen Einsatz dieses Fonds nennt Merkel einen Wirtschaftseinbruch in Irland als Folge des Brexits. Schon dieses Beispiel zeigt, wie wenig durchdacht die Idee ist. Nach welchen Kriterien soll über die Vergabe der Mittel entschieden werden? Wer entscheidet darüber? Und wie erklärt sich, dass die Niederlande, die nach Irland am stärksten unter dem Brexit leiden werden, nichts von dem Fonds halten?
Hoekstra weist zu Recht darauf hin, dass die Hauptverantwortung für die Reform der Währungsunion in den Mitgliedstaaten liegen muss. Länder, die unverändert die alleinige Kompetenz in der Haushaltspolitik beanspruchen, dürfen nicht in die Lage versetzt werden, die Verantwortung für unsolides Wirtschaften nach Brüssel abzuschieben. Je mehr sie sich stattdessen mit Gemeinschaftsmitteln aus der Patsche ziehen können, desto stärker werden sie aus der Haftung für ihr Handeln entlassen. Neue Gemeinschaftsmittel für die Eurozone unterstützen die Tendenz zur kollektiven Verantwortungslosigkeit. Derzeit scheint das in Deutschland kaum jemanden zu kümmern. Das kann sich aber ändern.